Dominoeffekt ist unübersehbar - Hungersnot als letzte Folge
Die Satellitenfotos sind zauberhaft - und erschütternd zugleich: Sie zeigen den Tschadsee im Jahre 1963 - ein See so groß und weit wie ein Meer oder genauer: so groß wie Israel...
Wenn Sie ein aktiver Abonnent sind und der Artikel nicht angezeigt wird, Bitte melden Sie sich ab und wieder an. Kostenloser Zugriff auf Artikel ab 12:00 Uhr.
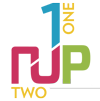
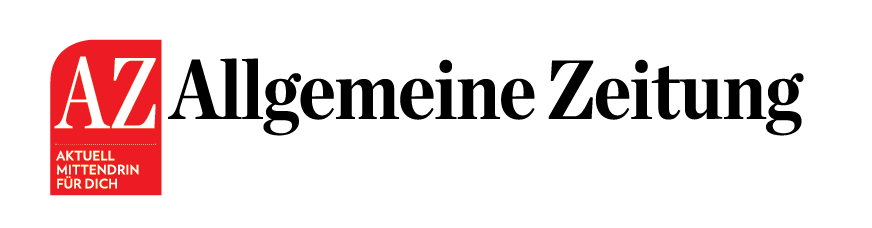


Kommentar
Allgemeine Zeitung
Zu diesem Artikel wurden keine Kommentare hinterlassen