Langzeitschäden bei Uranabbau
Stampriet-Wasserleiter durch unterirdische Aktivität gefährdet
Momentan ist die Kalahari-Gemeinschaft in ihrem Widerstand gegen einen möglichen In-Situ-Laugungsprozess im Stampriet-Wasserleiter nicht annähernd so gut organisiert wie die Kommunalbevölkerung, die sich im Kavango gegen die Ölexploration von ReconAfrica stellt. ,Earthlife' hat dagegen nun offen Stellung zu dem Thema bezogen.
Von Frank Steffen, Windhoek
Bisher ist Dr. Roy Miller der einzige, wenngleich renommierte Geologe, der sich offen gegen den geplanten In-Situ-Laugungsprozess in dem einzigartigen Stampriet-Artesischen-Becken (Stampriet Artesian Basin, SAB) stemmt. Während sich der Widerstand mehrt, ist er in keiner Weise mit dem Widerstand zu vergleichen, der sich inzwischen auf lokaler Ebene im Bereich der Gas- und Ölexploration in der Kavango-Region bemerkbar macht.
Miller hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass er die Explorationsaktivitäten im Kavango-Becken als ganz einfache Abzocke einschätzt und erklärte gegenüber der AZ: „Gas und Öl findet man nahezu in jedem Gestein, doch heißt dies längst nicht, dass es lohnend abgebaut werden kann. Das trifft übrigens auch auf nukleare Stoffe zu. Aber eines ist sicher, die Bodenbeschaffung im Kavango-Becken macht erstens ein Vorkommen höchst unwahrscheinlich und zweitens, selbst wenn Rohmaterial vorhanden ist, wird es extrem aufwändig und teuer, dies abzubauen. Darum nehme ich persönlich ReconAfrica gar nicht ernst. Aber die Uranexploration im Aquifer der Kalahari, das ist ein ernstzunehmendes Unternehmen! Hier geht es um unser Grundwasser.“
Gibt es im Falle ReconAfricas verschiedene Geologen, die der AZ immer wieder gern erklären, warum allein die Suche nach Gas- und Ölvorkommen im Kavango Unsinn darstellt und im Grunde eine einfache Gefahr für das Grundwasser darstellt, so blieben solche Stimmen im Falle des SABs bisher weitgehend aus. Erstaunlicherweise scheinen sich die Gemeinschaften in der Kavango-Region inzwischen besser in ihrem Widerstand gegen die Ölexploration organisiert zu haben, als die Gemeinschaft in der Kalahari gegen den Uranabbau.
Nicht nur Farmer betroffen
Entgegen der Annahme einiger Beobachter geht es bei dem seltenen Wasserleiter in der Kalahari nicht nur um die direkt betroffenen, umliegenden Farmer. Die Kalahari-Ortschaften Leonardville, Stampriet, Aranos, Hoachanas, Gochas, Koës und Aroab sowie hunderte Gästebetriebe und Wildfarmen sind davon nicht weniger betroffen, als das Aminuis-Reservat (Homeland) der Herero-Bevölkerung. Seltsamerweise betrifft es dabei maßgeblich erneut die beiden lokal-ansässigen Bevölkerungsgruppen der Nama und Herero (die sich momentan gemeinsam für eine Genozid-Wiedergutmachung einsetzen). Bisher ist es schwer zu erkennen, in wieweit sich die Farmer, Gastbetriebe, Städter und Kommunalbevölkerung zusammenfinden und gemeinsam gegen einen Uranabbau in dem SAB-Wasserleiter angehen.
Bertchen Kohrs von Earthlife Namibia schrieb nun an die AZ: „Headspring Investments will das Uran mit einer bisher in Namibia nicht erprobten Methode abbauen.“ Dies sei eine Methode, bei der „laut Experten zweifellos die Kontamination des Grundwassers mit Uran und anderen Schwermetallen in Kauf genommen wird, die die Trinkwasserversorgung nicht nur Namibias, sondern auch von Teilen des östlichen Botswanas und des nördlichen Südafrikas gefährden wird“. Sie betont, dass dies die einzige Trinkwasser-Ressource ist, die der Bevölkerung in dieser Umgebung zur Verfügung steht.
Sie erklärt ferner: „Bei der In-Situ-Laugung wird Säure durch hohen Druck über Bohrlöcher in die Erzlagerstätte gepresst. Dadurch wird das Uran aus dem Gestein gelöst. Die uranhaltige Flüssigkeit, die dabei entsteht, wird dann über andere Bohrlöcher an die Oberfläche gepumpt. Bei der In-Situ-Laugung findet der Abbau von Uran also rein unterirdisch statt. Oberirdisch sind unmittelbar keine Anzeichen von Verschmutzung erkennbar; die langfristigen Auswirkungen werden daher oft erst viel später bemerkt. Und dann ist es meist zu spät.“
Indessen hofft Miller auf eine inter-ministeriale Verständigung, bei der die Vernunft siegt und die „In-Situ-Laugung in dieser Gegend ein und für alle Male verboten wird“.
Bisher ist Dr. Roy Miller der einzige, wenngleich renommierte Geologe, der sich offen gegen den geplanten In-Situ-Laugungsprozess in dem einzigartigen Stampriet-Artesischen-Becken (Stampriet Artesian Basin, SAB) stemmt. Während sich der Widerstand mehrt, ist er in keiner Weise mit dem Widerstand zu vergleichen, der sich inzwischen auf lokaler Ebene im Bereich der Gas- und Ölexploration in der Kavango-Region bemerkbar macht.
Miller hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass er die Explorationsaktivitäten im Kavango-Becken als ganz einfache Abzocke einschätzt und erklärte gegenüber der AZ: „Gas und Öl findet man nahezu in jedem Gestein, doch heißt dies längst nicht, dass es lohnend abgebaut werden kann. Das trifft übrigens auch auf nukleare Stoffe zu. Aber eines ist sicher, die Bodenbeschaffung im Kavango-Becken macht erstens ein Vorkommen höchst unwahrscheinlich und zweitens, selbst wenn Rohmaterial vorhanden ist, wird es extrem aufwändig und teuer, dies abzubauen. Darum nehme ich persönlich ReconAfrica gar nicht ernst. Aber die Uranexploration im Aquifer der Kalahari, das ist ein ernstzunehmendes Unternehmen! Hier geht es um unser Grundwasser.“
Gibt es im Falle ReconAfricas verschiedene Geologen, die der AZ immer wieder gern erklären, warum allein die Suche nach Gas- und Ölvorkommen im Kavango Unsinn darstellt und im Grunde eine einfache Gefahr für das Grundwasser darstellt, so blieben solche Stimmen im Falle des SABs bisher weitgehend aus. Erstaunlicherweise scheinen sich die Gemeinschaften in der Kavango-Region inzwischen besser in ihrem Widerstand gegen die Ölexploration organisiert zu haben, als die Gemeinschaft in der Kalahari gegen den Uranabbau.
Nicht nur Farmer betroffen
Entgegen der Annahme einiger Beobachter geht es bei dem seltenen Wasserleiter in der Kalahari nicht nur um die direkt betroffenen, umliegenden Farmer. Die Kalahari-Ortschaften Leonardville, Stampriet, Aranos, Hoachanas, Gochas, Koës und Aroab sowie hunderte Gästebetriebe und Wildfarmen sind davon nicht weniger betroffen, als das Aminuis-Reservat (Homeland) der Herero-Bevölkerung. Seltsamerweise betrifft es dabei maßgeblich erneut die beiden lokal-ansässigen Bevölkerungsgruppen der Nama und Herero (die sich momentan gemeinsam für eine Genozid-Wiedergutmachung einsetzen). Bisher ist es schwer zu erkennen, in wieweit sich die Farmer, Gastbetriebe, Städter und Kommunalbevölkerung zusammenfinden und gemeinsam gegen einen Uranabbau in dem SAB-Wasserleiter angehen.
Bertchen Kohrs von Earthlife Namibia schrieb nun an die AZ: „Headspring Investments will das Uran mit einer bisher in Namibia nicht erprobten Methode abbauen.“ Dies sei eine Methode, bei der „laut Experten zweifellos die Kontamination des Grundwassers mit Uran und anderen Schwermetallen in Kauf genommen wird, die die Trinkwasserversorgung nicht nur Namibias, sondern auch von Teilen des östlichen Botswanas und des nördlichen Südafrikas gefährden wird“. Sie betont, dass dies die einzige Trinkwasser-Ressource ist, die der Bevölkerung in dieser Umgebung zur Verfügung steht.
Sie erklärt ferner: „Bei der In-Situ-Laugung wird Säure durch hohen Druck über Bohrlöcher in die Erzlagerstätte gepresst. Dadurch wird das Uran aus dem Gestein gelöst. Die uranhaltige Flüssigkeit, die dabei entsteht, wird dann über andere Bohrlöcher an die Oberfläche gepumpt. Bei der In-Situ-Laugung findet der Abbau von Uran also rein unterirdisch statt. Oberirdisch sind unmittelbar keine Anzeichen von Verschmutzung erkennbar; die langfristigen Auswirkungen werden daher oft erst viel später bemerkt. Und dann ist es meist zu spät.“
Indessen hofft Miller auf eine inter-ministeriale Verständigung, bei der die Vernunft siegt und die „In-Situ-Laugung in dieser Gegend ein und für alle Male verboten wird“.
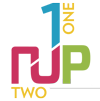
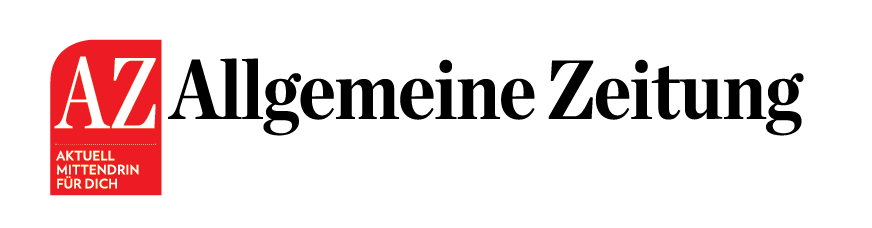

Kommentar
Allgemeine Zeitung
Zu diesem Artikel wurden keine Kommentare hinterlassen