Deutsche Museen wollen Raubkunst aus Kamerun zurückgeben
Dialogtreffen zwischen Deutschland und Kamerun in Stuttgart - Gespräche über Restitution
In Deutschland befinden sich etwa 40 000 Kulturgüter aus Kamerun – viele davon entstammen kolonialen Unrechtskontexten. Traditionelle Gemeinschaften in Kamerun fordern daher die Rückgabe ihrer Kunst- und Kulturgegenstände. In Stuttgart hat nun der Dialog darüber begonnen.
Von Katharina Moser, FrankfurtDie Restitution von in Kolonialkontexten entwendeten Kulturgütern und Kunstgegenständen ist ein enorm wichtiger Bestandteil der Wiedergutmachung von...
Wenn Sie ein aktiver Abonnent sind und der Artikel nicht angezeigt wird, Bitte melden Sie sich ab und wieder an. Kostenloser Zugriff auf Artikel ab 12:00 Uhr.
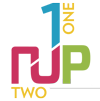
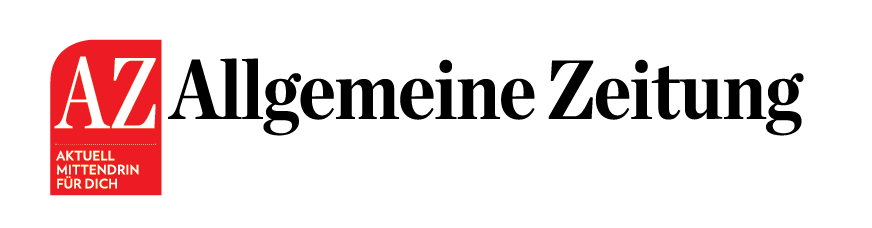


Kommentar
Allgemeine Zeitung
Zu diesem Artikel wurden keine Kommentare hinterlassen