Was, wo und wer wir sind – eine Standortbestimmung
Sondern sich Namibier deutscher Herkunft im Jahr 2020 aus der Gesellschaft und vom politischen Mitbestimmungsrecht genauso ab, wie sie es – mit wenigen Ausnahmen - in den 60-iger und Anfang 70-iger Jahre taten? Gerhard Tötemeyer, u. A. früherer Wahlleiter, ehemals Vizeminister für Regional- und Kommunalverwaltung sowie emeritierter Akademiker der Verwaltungswissenschaft an mehreren Universitäten im südlichen Afrika, hat zu der Frage mit Blick zurück, mit einer aktuellen politischen Analyse der Gegenwart sowie mit Blick nach vorn einen Beitrag verfasst, der sich unter anderen mit der Rolle deutschsprachiger Namibier befasst. Kurz nach der Unabhängigkeit Namibias hat Tötemeyer schon einmal ein Profil über hiesige Deutschsprachige herausgebracht. Die aktuellen „Gedanken“ gehen jedoch weit über ein ethnisch-kulturelles Bild der mehrsprachigen Gruppe hinaus, zu der er gehört und sich bekennt, indem er Anregungen und Vorschläge unterbreitet, wie Deutschsprachige des Landes sich konstruktiver in Politik und Gesellschaft einbringen können. Gleichzeitig will er die Anregungen nicht als Vorschrift verstanden haben, denn „ … es gibt kein Kursbuch für die Deutschsprachigen in Namibia, wie sie sich verhalten sollen.“
Das Gruppenprofil stellt der Autor in den aktuellen staatspolitischen Rahmen, der am Anfang des vierten Jahrzehnts namibischer Souveränität von Krisen und Schwächen geschüttelt wird: „Namibia befindet sich bereits in einem Zustand der Plutokratie und Kleptokratie. Wohlhabende, obwohl nicht alle, versuchen mit Erfolg durch Korruption den Staat für den Eigennutz zu kapern und ihm materiellen Schaden zuzufügen.“ Solch parasitäre Mentalität unter Führungseliten, wodurch Entwicklung und Sozialleistung gehemmt und verhindert werden, haben andere Autoren als Mentalität beschrieben, bei der machthabende Entscheidungsträger nicht Diener des Volkes sind, sondern den Staat als Beute vereinnahmen (Wann startet Afrika? Olzog-Verlag, 2001). In Südafrika spricht man inzwischen von „state capture“.
Auf die namibischen Nationalversammlung kommt derzeit die NEEEB-Gesetzesvorlage (National Equitable Economic Empowerment Bill) zu, die Tötemeyer wie andere Kritiker als einen Entwurf mit „rassistischen Untertönen“ beschreibt. Die Regierung verfolge eine politisch eigennützige Vorgehensweise. Er erwähnt dies als Beispiel unter den Ursachen, die zur Abwanderung junger schwarzer und weißer professioneller Namibier führt, genannt „brain drain“. „Auf- und Ausbau einer demokratischen Gesellschaft und seiner Wirtschaft darf nicht auf Hautfarbenzugehörigkeit bestehen“, lautet die Kritik.
Die Schrift ist eine nützliche Handreichung über die deutschsprachige Gemeinschaft seit der Kolonialzeit, gefolgt von der Ära südafrikanischer Verwaltung mit dem System der Apartheid und aktuelle über den jungen Staat, seine Strukturen und Verfassung, verbunden mit Gedanken zur Zukunft, wie der verfassungsmäßige Rechtsstaat vor Gefahren gefestigt und ausgebaut werden kann - eine informativ-verständliche namibische Staats- und Gesellschaftslehre. Die Deutschsprachigen haben dabei eine Rollenfunktion. Tötemeyer skizziert ihren möglichen Einsatz und zukünftige Aufgaben.
Im Abschnitt über die Vergangenheit und im Bewusstsein, wie koloniale Geschichte auch im 21. Jahrhundert Themen hervorbringt, mit denen sich Nachfolgegenerationen zu befassen haben, mahnt der Autor: „Sachliche Aufarbeitung der kolonialen Geschichte ist eine bleibende Aufgabe.“ Um Gespräche miteinander zu führen und Vertrauen zu bilden. Er warnt vor Geschichtsverfälschung, Geschichtsverdrehung und Geschichtsverschweigung. In diesem Rahmen muss auch seine eigene Schrift knapp, sachlich ergänzt werden. Als Beispiel neuralgischer Punkte, an dem sich die Geister scheiden, nennt Tötemeyer den Ausmerzungsbefehl vom Oktober 1904, auch Schießbefehl gegen die Herero genannt (Dr. Hans-Joachim Rust). Dass die Proklamation zwei Monate später auf Bestreben von Reichskanzler von Bülow von Kaiser Wilhelm II widerrufen wurde, gehört hier zumindest in einem Nebensatz dazu. Die Reparationslobby und postfaktischen Historiker verschweigen die Widerrufung konsequent. Letztere rühmen sich dann, Kolonialgeschichte aus der Amnesie befreit zu haben, wobei sie ihre magere Faktenbasis auffällig in Süffisanz verbrämen.
Der Vorzug der „Gedanken-Schrift“ besteht darin, dass sie fundierte Anregungen zu konstruktivem Engagement für die Gegenwart bietet, wobei die heutige Generation aller Schattierungen, ob sie es wahrhaben will oder nicht, auf den Schultern ihrer Vorfahren steht. Eberhard Hofmann
„Gedanken zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Namibias“ von Gerhard Tötemeyer. Die Schrift umfasst 35 Seiten und stammt aus dem Gesprächskreis Deutschsprachiger Namibier. Druck: Magic Copy Centre Swakopmund, August 2020. ISBN 978-99916-970-9-3. Unverbindlicher Richtpreis: 35 N$.
Das Gruppenprofil stellt der Autor in den aktuellen staatspolitischen Rahmen, der am Anfang des vierten Jahrzehnts namibischer Souveränität von Krisen und Schwächen geschüttelt wird: „Namibia befindet sich bereits in einem Zustand der Plutokratie und Kleptokratie. Wohlhabende, obwohl nicht alle, versuchen mit Erfolg durch Korruption den Staat für den Eigennutz zu kapern und ihm materiellen Schaden zuzufügen.“ Solch parasitäre Mentalität unter Führungseliten, wodurch Entwicklung und Sozialleistung gehemmt und verhindert werden, haben andere Autoren als Mentalität beschrieben, bei der machthabende Entscheidungsträger nicht Diener des Volkes sind, sondern den Staat als Beute vereinnahmen (Wann startet Afrika? Olzog-Verlag, 2001). In Südafrika spricht man inzwischen von „state capture“.
Auf die namibischen Nationalversammlung kommt derzeit die NEEEB-Gesetzesvorlage (National Equitable Economic Empowerment Bill) zu, die Tötemeyer wie andere Kritiker als einen Entwurf mit „rassistischen Untertönen“ beschreibt. Die Regierung verfolge eine politisch eigennützige Vorgehensweise. Er erwähnt dies als Beispiel unter den Ursachen, die zur Abwanderung junger schwarzer und weißer professioneller Namibier führt, genannt „brain drain“. „Auf- und Ausbau einer demokratischen Gesellschaft und seiner Wirtschaft darf nicht auf Hautfarbenzugehörigkeit bestehen“, lautet die Kritik.
Die Schrift ist eine nützliche Handreichung über die deutschsprachige Gemeinschaft seit der Kolonialzeit, gefolgt von der Ära südafrikanischer Verwaltung mit dem System der Apartheid und aktuelle über den jungen Staat, seine Strukturen und Verfassung, verbunden mit Gedanken zur Zukunft, wie der verfassungsmäßige Rechtsstaat vor Gefahren gefestigt und ausgebaut werden kann - eine informativ-verständliche namibische Staats- und Gesellschaftslehre. Die Deutschsprachigen haben dabei eine Rollenfunktion. Tötemeyer skizziert ihren möglichen Einsatz und zukünftige Aufgaben.
Im Abschnitt über die Vergangenheit und im Bewusstsein, wie koloniale Geschichte auch im 21. Jahrhundert Themen hervorbringt, mit denen sich Nachfolgegenerationen zu befassen haben, mahnt der Autor: „Sachliche Aufarbeitung der kolonialen Geschichte ist eine bleibende Aufgabe.“ Um Gespräche miteinander zu führen und Vertrauen zu bilden. Er warnt vor Geschichtsverfälschung, Geschichtsverdrehung und Geschichtsverschweigung. In diesem Rahmen muss auch seine eigene Schrift knapp, sachlich ergänzt werden. Als Beispiel neuralgischer Punkte, an dem sich die Geister scheiden, nennt Tötemeyer den Ausmerzungsbefehl vom Oktober 1904, auch Schießbefehl gegen die Herero genannt (Dr. Hans-Joachim Rust). Dass die Proklamation zwei Monate später auf Bestreben von Reichskanzler von Bülow von Kaiser Wilhelm II widerrufen wurde, gehört hier zumindest in einem Nebensatz dazu. Die Reparationslobby und postfaktischen Historiker verschweigen die Widerrufung konsequent. Letztere rühmen sich dann, Kolonialgeschichte aus der Amnesie befreit zu haben, wobei sie ihre magere Faktenbasis auffällig in Süffisanz verbrämen.
Der Vorzug der „Gedanken-Schrift“ besteht darin, dass sie fundierte Anregungen zu konstruktivem Engagement für die Gegenwart bietet, wobei die heutige Generation aller Schattierungen, ob sie es wahrhaben will oder nicht, auf den Schultern ihrer Vorfahren steht. Eberhard Hofmann
„Gedanken zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Namibias“ von Gerhard Tötemeyer. Die Schrift umfasst 35 Seiten und stammt aus dem Gesprächskreis Deutschsprachiger Namibier. Druck: Magic Copy Centre Swakopmund, August 2020. ISBN 978-99916-970-9-3. Unverbindlicher Richtpreis: 35 N$.
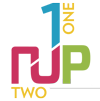
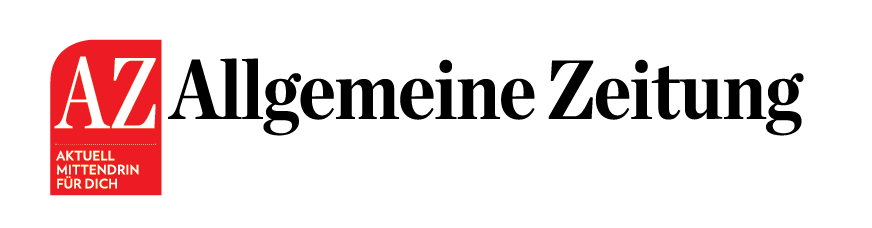
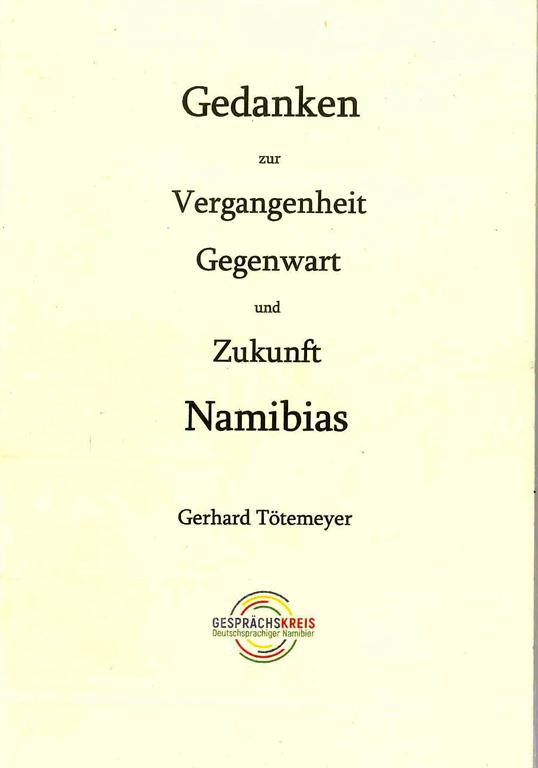

Kommentar
Allgemeine Zeitung
Zu diesem Artikel wurden keine Kommentare hinterlassen